Planetare Gesundheit in ErgoLogoPhysio

Welche Rolle spielen wir als Therapeut:innen in der Klimakrise? Aus diversen Perspektiven soll diese Frage zukunftsweisend beantwortet werden. Wir alle sind gefragt, Antworten zu finden und die notwendige Transformation als Change Agents aktiv zu mitzugestalten.
„Gesundheit bewegt wie fast nichts andere.“
Dr. Martin Herrmann während der ersten Session „GRUNDLAGEN DER PLANETAREN GESUNDHEIT – ENTDECKE DIE HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN ALS THERAPEUT:IN“
Planetare Gesundheit ist längst mehr als ein abstraktes Zukunftskonzept. Sie beschreibt den untrennbaren Zusammenhang zwischen der Gesundheit von Menschen und der Gesundheit der natürlichen Lebensgrundlagen. Für alle, die in Physio-, Ergo- oder Logotherapie arbeiten, ergibt sich daraus eine zentrale Frage: Welche Rolle spielen wir in einer globalen Krise, die Gesundheit auf allen Ebenen bedroht? Die Antwort ist vielschichtig und eröffnet neue Perspektiven auf therapeutisches Handeln, berufliche Verantwortung und gesellschaftliche Teilhabe.
Gesundheit neu gedacht
Die Klimakrise ist kein fernes Risiko, sondern ein realer Einflussfaktor auf den Alltag in der Therapie. Hitzeperioden, Luftverschmutzung, steigende Allergien, zunehmende psychische Belastungen – all das zeigt, dass Wohlbefinden und Krankheit längst nicht mehr nur individuell erklärbar sind. Gesundheit kann nur noch verstanden werden als Ergebnis komplexer Wechselwirkungen zwischen Mensch, Natur, sozialen Systemen und globalen Dynamiken.
Für uns bedeutet dies: Therapeutische Arbeit findet nicht mehr ausschließlich am Behandlungstisch statt. Sie wird eingebettet in gesellschaftliche Transformationsprozesse, in denen medizinische und therapeutische Institutionen eine systemische Rolle spielen.
Therapeut:innen als Change Agents
In Zeiten planetarer Krisen wird unsere Tätigkeit zu einer zukunftsweisenden Ressource. Therapeut:innen können zu Change Agents werden – Personen, die aktiv an der Gestaltung nachhaltiger Entwicklungen beteiligt sind. Dazu braucht es weniger ein radikales Neudenken der Professionen als vielmehr eine bewusste Erweiterung des bestehenden Selbstverständnisses.
Drei zentrale Dimensionen zeichnen diese Rollen aus
1. Wahrnehmung wandeln: Gesundheit muss in den Köpfen und im öffentlichen Diskurs anders verstanden werden. Wir können dazu beitragen, indem wir Umweltfaktoren und gesellschaftliche Dynamiken in unsere Analysen und Behandlungsprozesse integrieren. Wenn eine Patientin unter stärkerer Atemnot leidet, kann neben der muskulären Kondition auch die Luftqualität eine Rolle spielen. Wenn ein Patient psychische Erschöpfung schildert, kann dies auch Ausdruck klimabezogener Belastungen oder Zukunftsängste sein. Dieses Bewusstsein verändert Diagnostik und therapeutische Intervention.
2. Wissen teilen: Therapeut:innen sind vertraute Ansprechpartner:innen in Gesundheitsfragen. Gerade deshalb eignen wir uns hervorragend, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu Umwelt- und Klimafolgen verständlich zu kommunizieren. Das muss nicht missionarisch geschehen. Oft reicht es, Zusammenhänge anzusprechen, Alternativen aufzuzeigen oder Fragen anderer aufzunehmen. Kontinuierliche Aufklärung wirkt häufig nachhaltiger als dramatische Appelle.
3. Transformation mitgestalten: Therapeutisches Handeln ist immer Teil institutioneller Strukturen. Viele Praxen, Kliniken und Hochschulen entwickeln bereits Nachhaltigkeitsstrategien. Wir können diese Prozesse unterstützen, praktische Vorschläge machen oder eigene Initiativen anstoßen – sei es durch ökologische Beschaffung, energieeffiziente Praxisorganisation, digitale Angebote oder Kooperationen mit lokalen Akteur:innen. Veränderung entsteht durch alltägliches Handeln und kollektive Prozesse.
Planetare Gesundheit im therapeutischen Alltag
Wie kann diese Perspektive im Alltag einer ergo-, logo- oder physiotherapeutischen Einrichtung aussehen?
Ökologisierung von Organisationsstrukturen: Viele Praxisabläufe sind ressourcenintensiv. Digitale Dokumentation, papierärmere Patient:innenverwaltung, langlebige Therapiegeräte, Sharing-Konzepte oder Recyclingmaterialien sind konkrete Schritte, die nicht nur ökologisch sinnvoll sind, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen können.
Therapeutische Interventionen im Freien: Bewegungstherapie im Park, ergotherapeutische Alltagstrainings im Außenraum oder logopädische Übungen im Freien verbinden gesundheitliche Ziele mit Naturerfahrung. Studien zeigen, dass Naturkontakt Stress reduziert, Motivation erhöht und positive Effekte auf kognitive und psychische Prozesse haben kann. Gleichzeitig wird bei Patient:innen ein Bewusstsein dafür gestärkt, dass Gesundheit untrennbar mit Umweltbedingungen verbunden ist.
Stärkung sozialer Teilhabe: Klimawandel ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales Problem. Vulnerable Gruppen – ältere Menschen, einkommensschwache Haushalte, chronisch Erkrankte – sind besonders betroffen. Therapeut:innen arbeiten häufig genau mit diesen Gruppen und können ihre Perspektiven sichtbar machen. Wenn Patient:innen Schwierigkeiten haben, mit Hitzeperioden umzugehen oder gesundheitliche Einschränkungen durch schlechte Infrastruktur erleben, kann dies zum Anlass für individuelle Unterstützung und institutionelle Forderungen werden.
Politische Verantwortung: Gesundheitsberufe sind historisch eng verknüpft mit sozialer Verantwortung. Die Klimakrise verschiebt diese Verantwortung in einem neuen Maßstab. Politische Positionierung muss nicht laut und kämpferisch sein. Sie kann auch durch fachliche Expertise, Stellungnahmen oder Mitarbeit in Verbänden erfolgen.
Viele berufsständische Organisationen beginnen bereits, Klimaschutz und planetare Gesundheit in Leitbilder zu integrieren. Wir können diese Entwicklungen begleiten, indem wir Forderungen unterstützen oder selbst zu Dialogen beitragen. Das schützt nicht nur die eigene berufliche Zukunft, sondern hilft auch, den Stellenwert von Gesundheitsberufen in gesellschaftlichen Umbruchzeiten sichtbar zu machen.
Ethische Perspektiven
Planetare Gesundheit berührt grundlegende ethische Fragen:
- Welche Verantwortung trägt eine therapeutische Profession gegenüber zukünftigen Generationen?
- Wie lässt sich Verantwortung mit begrenzten Ressourcen im Berufsalltag vereinbaren?
- Wie kann professionelles Handeln gesellschaftliche Auswirkungen berücksichtigen, ohne patientenorientierte Kernaufgaben zu verlieren?
Antworten entstehen nicht im Alleingang. Einrichtungen, Berufsverbände, Forschung und Praxis müssen sie gemeinsam entwickeln. Wichtig ist, dass aus Unsicherheit keine Passivität wird. Selbst kleine Beiträge im Alltag haben Wirkung – und sie signalisieren, dass die Gesundheitsprofessionen Teil der Lösung sind.
Bildung und Qualifizierung
Damit Therapeut:innen in diesem Feld wirksam werden können, braucht es auch eine Weiterentwicklung der Profession selbst. Inhalte zu Nachhaltigkeit, Klimawandel und planetarer Gesundheit gewinnen in der Ausbildung an Bedeutung. Hochschulen beginnen, Module zu entwickeln, die ökologische, soziale und gesundheitliche Aspekte miteinander verknüpfen. Dadurch entsteht langfristig ein Fachverständnis, das den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.
Fortbildungen und berufsbegleitende Angebote können diesen Weg vertiefen. Manche Praxen entwickeln interne Nachhaltigkeitskonzepte oder bilden Teams, die ökologische Maßnahmen koordinieren. Andere arbeiten mit Gesundheitsämtern, Umweltinitiativen oder kommunalen Netzwerken zusammen. Jede dieser Optionen ist ein Schritt hin zu einer zukunftsfähigen therapeutischen Praxis.
Planetare Gesundheit: Quo vadis?
Planetare Gesundheit eröffnet ErgoLogoPhysio neue Handlungsräume. Die Klimakrise verändert den Kontext therapeutischer Arbeit und verlangt ein erweitertes Verantwortungsbewusstsein. Als Therapeut:innen stehen wir in direktem Austausch mit Menschen, die von gesundheitlichen und gesellschaftlichen Veränderungen betroffen sind. Genau daraus entsteht eine besondere Gestaltungskraft. Wir können:
- Wahrnehmung verändern,
- Wissen vermitteln,
- institutionelle Strukturen transformieren
- und damit zu aktiven Akteur:innen einer gesellschaftlichen Zukunft werden, die Gesundheit umfassend versteht.
Diese Rolle ist weder ideologisch noch utopisch, sondern Ausdruck eines realen gesellschaftlichen Bedarfs: Gesundheitssysteme müssen Teil der Lösung sein, wenn ökologische und soziale Krisen sich verstärken. Ergo-, Logo- und Physiotherapie können dabei einen wichtigen Beitrag leisten – nicht nur im Behandlungsraum, sondern als gestaltende Professionen in einer Welt im Wandel.
Weiterführende Links
Klima und Gesundheit – evidenzbasierte Medizin für die Zukunft
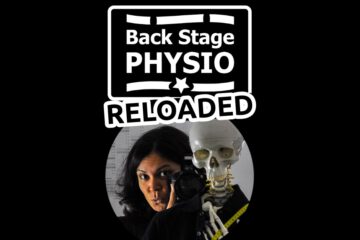


1 Kommentar
Publikationsliste - Kathrin Rosi Würtz · 22/11/2025 um 2:47 p.m.
[…] Planetare Gesundheit in ErgoLogoPhysio (2025 @ backstegphysio.de) […]
Die Kommentare sind geschlossen.